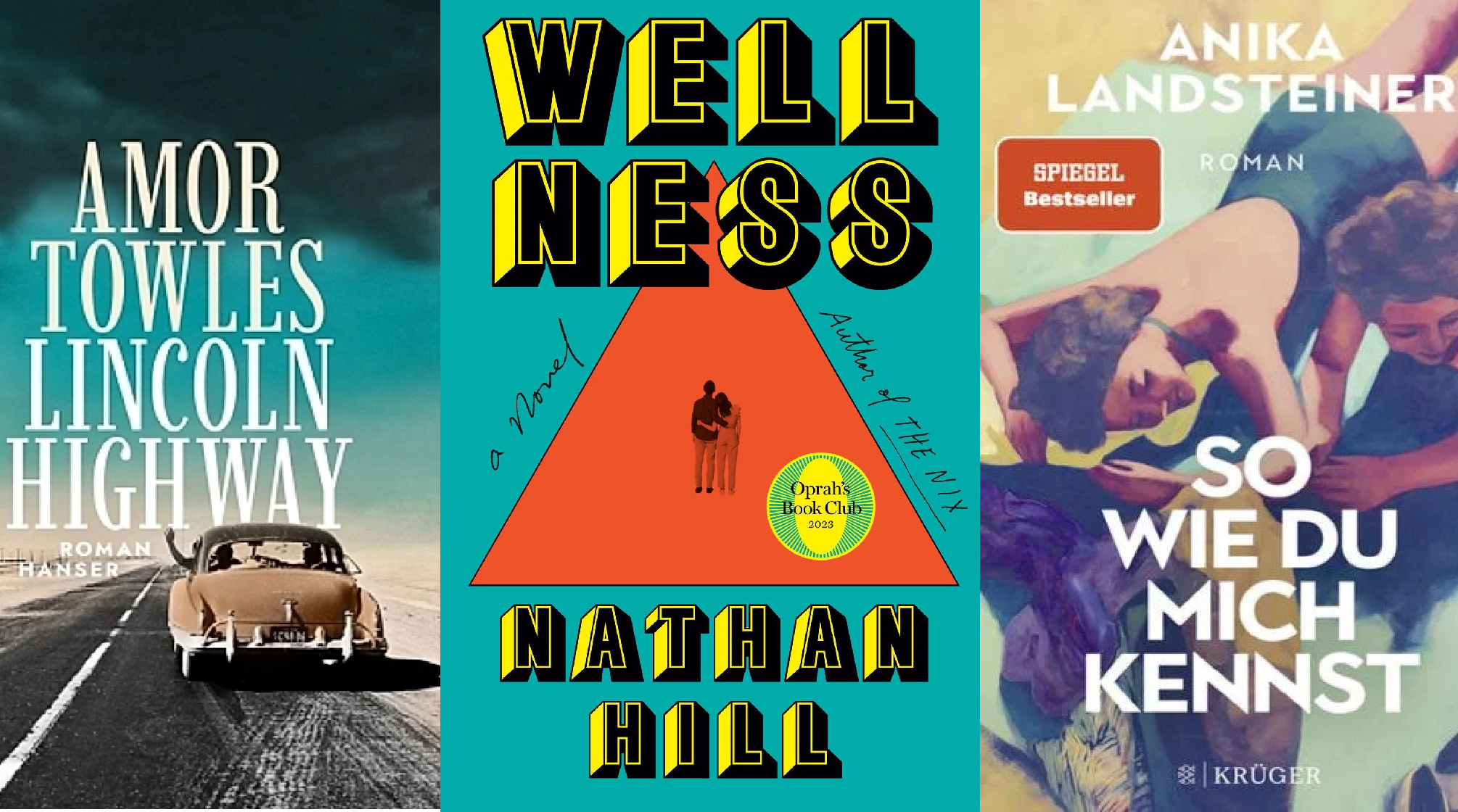Wir schreiben die Kalenderwoche 18, gelesene (oder gehörte) Bücher: 12. Das Spiel dürfte inzwischen bekannt sein, daher komme ich gleich zum Punkt: hier ein kleines Best-of:
 John Lanchester, The Wall
John Lanchester, The Wall
Liest man die Kritiken zu John Lanchesters Buch “The Wall”, wird vor allem in Deutschland gerne betont, dass Lanchester die Idee zu dem Buch hatte, als Donald Trump noch nicht Präsident war und auch der Brexit noch in weiter Ferne war. Nun habe die Realität das Buch quasi doppelt eingeholt. Das stimmt ein bisschen. Es greift aber zu kurz.
John Lanchester entwirft das Bild einer fernen, aber doch nicht allzu fernen Zukunft. Der Klimawandel, im Buch immer nur als “The Change” bezeichnet, hat die Meeresspiegel ansteigen lassen. Massenhaft flüchten die Menschen aus dem nahezu unbewohnbaren Süden in den Norden. Großbritannien reagiert mit völliger Abschottung. Um sich vor den Flüchtlingen zu schützen, hat das Land seine Küstenlinie mit einer Mauer umgeben: zehntausend Kilometer lang, fünf Meter hoch. Alle drei Kilometer gibt es ein Wachhaus. Jeder junge Mensch, egal ob Mann oder Frau, muss hier zwei Jahre Dienst tun. Dieser Dienst ist meistens vor allem eines: unglaublich eintönig. Andererseits aber auch sehr gefährlich. Immer wieder versuchen Gruppen von Flüchtlingen die Mauer zu überwinden, mit dem Mut der Verzweiflung, aber zum Teil auch gut bewaffnet.
Das alles erfährt der Leser eher nebenbei. Erzählt wird es ihm von einem jungen Mann, Joseph Kavanagh, der seine erste Wache auf der Mauer antritt. Eher nebenbei erfährt der Leser auch, was einer Wache droht, in deren Schicht es einem oder mehreren Flüchtlingen gelingt, die Mauer zu überwinden: für jeden erfolgreichen Eindringling wird eine Wache dazu verurteilt, auf einem Schiff auf dem Meer ausgesetzt zu werden. Die Flüchtlinge dagegen, die im Buch immer nur als “The Others”, “die Anderen”, bezeichnet werden, haben von Anfang an keine Chance. Da ihnen der implantierte Chip fehlt, mit denen sich alle Einwohner der Insel ausweisen, werden sie früher oder später entdeckt und haben die Wahl: sterben oder in einem sklavenähnliches Dienstverhältnis für die reguläre Bevölkerung arbeiten.
Wie alle, die an der Mauer Dienst tun müssen, ist Kavanagh noch jung. Er kennt keine andere Welt. Anders die Generation seiner Eltern, die niemals Dienst auf der Mauer tun mussten. Statt einer Mauer gab es in ihrer Jugend Strände – etwas, das Kavanagh nur von Fernsehbildern kennt. Während seine Eltern also nicht nachempfinden können, was er durchmachen muss, war es gleichzeitig ihre Generation, die es überhaupt soweit haben kommen lassen. Sie sind Schuld, dass die Welt zu dem Ort geworden ist, der sie nun einmal ist – Fridays for Future lässt grüßen.
Über die Situation “der Anderen” reflektiert Kavanagh kaum. Als ein junger Politiker die Wachmannschaften besucht und vor Kollaborateuren in den eigenen Reihen warnt, die Verständnis für “die Anderen” hätten, löst das wenig bis nichts in ihm aus. Gedanken macht er sich eher über das Verhältnis von normaler Bevölkerung zu den sogenannten “Eliten”. Sie sind die einzigen, die noch mit Flugzeugen reisen dürfen, um wichtige Verhandlungen zu führen – worüber auch immer. Kavanagh verachtet sie einerseits, gleichzeitig hofft er, eines Tages in ihre Reigen aufsteigen zu können.
Bis Kavanagh sich plötzlich selbst auf einem Boot wiederfindet, ausgesetzt irgendwo auf dem Meer. An seinem Abschnitt sind mehrere “Andere” durchgebrochen. Gemäß der geltenden Regeln wird er des Landes verwiesen. Die Hoffnung, das alles könne ein Irrtum gewesen sein, zerschlägt sich schnell. Statt dessen muss Kavanagh einsehen, dass er nun irgendwie selbst zu “den Anderen” gehört.
Lanchester entwickelt seine Geschichte langsam und bleibt oft vage. Das ist die große Stärke des Romans: dass er vieles nicht erzählt. Als Leser bleibt man nah am erzählenden Kavanagh, der selbst vieles entweder selbst nicht weiß, nicht versteht oder eben als bekannt voraussetzt. Die Geschichte macht das um so intensiver, weil einem als Leser der Blick aufs große Ganze bis zuletzt verwehrt bleibt. Wie es in der restlichen Welt und in anderen Ländern aussieht, kann man nur erahnen. Ebenso wie “The Change” genau ablief und wie schwerwiegend die Folgen sind. Auch wer “die Anderen” sind, wo sie herkommen, wie sie aussehen, bleibt im Dunkeln. All das weiß Kavanagh nicht, darum bleibt es auch für den Leser verschwommen.
Hinzu kommt, dass das Bild, das Lanchester zeichnet, sich nur in wenigen Details von der heutigen Welt zu unterscheiden scheint. Es wird nichts Neues erfunden, nur Bestehendes weitergedacht. Das lässt das Buch so eindringlich wirken, dass man sogar gerne über offensichtliche Schwächen hinweg sieht – etwa warum es zwar kein Problem ist, jeden Einwohner des Landes per Chip-Implantat zu identifizieren, die Grenzsicherung aber gänzlich ohne technische Hilfsmittel auskommen muss und auf eine einzelne Mauer beschränkt ist.
 Benedict Well, Vom Ende der Einsamkeit
Benedict Well, Vom Ende der Einsamkeit
Ich mag Bücher, die keinen klaren Spannungsbogen haben. Die eher ein Fenster aufmachen und dem Leser das Gefühl geben, für einen bestimmten Zeitraum am Leben des oder der Protagonisten teilhaben zu dürfen. Bücher, die nicht wirken, als hätte der Autor vorher einen Handlungsplan mit wichtigen Szenen skizziert, die er nun noch hier und da mit Detailbeschreibungen ausstopft. Vom Ende der Einsamkeit ist so ein Buch.
Jules ist zehn Jahre als, als seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen. Gemeinsam mit seinen beiden älteren Geschwistern, Marty und Liz, landet er auf einem Internat. Mit dem Verlust der Eltern geht jedes der drei Kinder anders um. Liz flüchtet sich in Drogen und Männergeschichten, fest überzeugt, ohnehin kein langes Leben vor sich zu haben, das aber genießen zu wollen. Marty entwickelt seltsame Ticks, kann keine Tür schließen, ohne nicht die Türklinke mehrfach runter drücken zu müssen. Er fängt sich aber ansonsten am schnellsten der drei wieder und macht mit einer Internet-Firma das große Geld. Aus dem mutigen, draufgängerischen Jules dagegen wird ein grübelnder Einzelgänger. Einzig seine Mitschülerin Alva, ebenfalls ein Sonderling, die als Kind einen schweren Verlust verkraften musste, lässt er an sich heran. Dennoch dauert es Jahre, bis die beiden wirklich zueinander finden und zumindest für kurze Zeit glücklich sein dürfen.
Den größten Teil des Buches schildert Well restrospektiv, aus der Perspektive des inzwischen über 40-Jährigen Jules, inzwischen selbst zweifacher Vater, der nach einem Motorradunfall im Krankenhaus zu sich kommt. Von hier aus schildert der Ich-Erzähler seinen Weg durchs Leben, immer ausgehend von der Frage, wann er wieder der sein darf, der er war, als seine Eltern noch lebten, und ob es nicht einen anderen Weg gegeben hätte, den er nur hätte gehen müssen.
“Ich kenne den Tod schon lange, doch jetzt kennt der Tod auch mich.” Schon dieser erste Satz ist stark und macht klar, hier geht es um mehr als nur eine Liebesgeschichte – die das Buch im Grunde genommen auch gar nicht ist. Vielmehr geht es um die großen Fragen nach verpassten Chancen und der eigenen Bestimmung, darum, wie viel im Leben vorbestimmt und wie viel steuerbar ist. Das verpackt Wells, selbst erst Mitte 30, in eine Geschichte, die man schon alleine deshalb nicht aus der Hand legen mag, weil sie so schön geschrieben ist.
 Frank Goosen, Förster, mein Förster
Frank Goosen, Förster, mein Förster
Liebster noch lebender Musiker? Elvis. Liebster nicht mehr lebender Musiker? Keith Richards. So schreibt es Förster, der auch von seinen Freunden nur beim Nachnamen genannt wird, als Antwort in den Fragebogen eines Berliner Stadtmagazins. Dass er den ausfüllen darf, hat sein Agent für ihn ausgehandelt. Denn Förster ist Schriftsteller und hat schon länger nichts mehr veröffentlicht. Nun soll er in einer Berliner Buchhandlung aus seinem letzten Buch vorlesen, eine Promo-Aktion, mit der er die Zeit bis zu seinem nächsten Buch überbrücken soll. Dummerweise versteht die junge Journalistin des Stadtmagazins den Scherz nicht, so wie sie auch vieles andere in dem Fragebogen nicht versteht. Am Ende wird es nichts mit der Veröffentlichung und auch nichts mit der Lesung – außer dem Inhaber des Buchladens kommt nämlich niemand, um Förster zuzuhören.
“Förster, mein Förster” ist so etwas wie die Fortsetzung von “Kein Wunder”, auch wenn Gossen letzteres erst danach geschrieben hat. Aus Förster ist ein Schriftsteller geworden, der allerdings schon länger mit einer Schreibblockade zu kämpfen hat und demnächst seinen 50. Geburtstag feiert. Sein neuestes Buch besteht bisher aus genau einem Satz. Kumpel Fränge, der in “Kein Wunder” sowohl in Ost- als auch in Westberlin eine Freundin hatte, ist verheiratet und gerade dabei, seine Ehe vor die Wand zu fahren, weil er mit einer Kellnerin aus der von ihm geführten Kneipe anbandelt. Brocki ist Lehrer und mit allem auf dem Kriegsfuß, was nach 1990 entwickelt wurde – Mobiltelefone, moderne Musik, Werbesprache und so weiter. Ergänzt wird dieses Trio durch eine Reihe weiterer, nicht minder schräger gestalten, allen voran Försters hochbetagten und etwas verrückte Nachbarin, ehemals Saxofonistin der “Tanzkapelle Schmidt”. Eben diese Tanzkapelle hat zur großen Reunion gerufen – also machen sich die Freunde auf an die Ostsee, wo die große Wiedervereinigung stattfinden soll.
Wie schon “Kein Wunder” lebt auch “Förster, mein Förster” weniger vom Plot selbst, der sich ohnehin eher zäh entwickelt und erst am Ende etwas Fahrt aufnimmt. Vielmehr sind es die teils kuriosen, aber auch melancholisch erzählten Feinheiten, die das Buch ausmachen. Wenn Förster zu Beginn der Geschichte nach einer langen Nacht mit Kumpel Fränge mit einer leeren Bierflasche in der Hand nach Hause stapft etwa. Erst überlegt er, diese von einer Brücke auf die Bahngleise zu werfen – ein bisschen Anarcho-Aufbäumen mit Ende vierzig, sozusagen. Dann kann er sich aber doch nicht dazu durchringen. In der Folge wird er von jedem, den er über den Weg läuft, gefragt, wieso er eine leere Bierflasche mit sich rumtrage. “Da ist noch Pfand drauf”, antwortet Förster stets blödsinnigerweise, was dann mit einem wissenden “Ach so” quittiert wird.
Es sind diese Kleinigkeiten, die Goosen so liebevoll in die Handlung einpflegt, dass sie zwar für sich genommen kurios wirken, aber eigentlich gar nicht so weit weg sind von der Realität, in der ja die wenigsten Menschen stets logisch und nachvollziehbar handeln. Das gleiche gilt für die Gedankengänge seines Helden, denen Goosen sich wieder intensiv widmet und die sich immer wieder um die Frage drehen: war früher eigentlich wirklich alles besser? Was erwartet einen noch im Leben, wenn man relativ sicher sein kann, mehr als die Hälfte davon bereits hinter sich zu haben? So viel vorweg: eine Antwort auf diese Fragen gibt es nicht. Zu lesen, wie Goosens Figuren sich an ihnen abarbeiten, macht aber trotzdem großen Spaß, wenn auch vielleicht einen Tick weniger als bei “Kein Wunder”.
In diesem Sinne – viel Spaß beim Lesen und mehr Bücherposts gibt es hier!